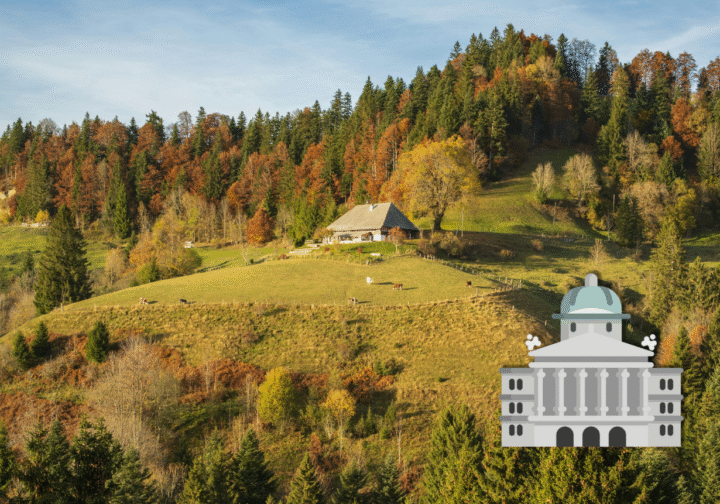Nomen est omen: In den Selbsterntegärten von Madeleine Michel und Olivia Stafflage ernten die Abonnentinnen und Abonnenten ihr Gemüse selbst – so auch im Klostergarten der Benediktinerinnen in Sarnen. Ein Besuch vor Ort und die Geschichte einer Idee, die immer mehr Wurzeln schlägt.

Die Gartensaison ist eben erst gestartet, als ich Olivia Stafflage an einem Frühlingsmorgen in Sarnen treffe. Entsprechend ist es noch ruhig im Garten – nicht nur wegen der Klostermauern, die das Grundstück mitten im Dorf umgeben. Ein friedlicher Ort, in dem mir Olivia die Geschichte und Idee der Selbsterntegärten näherbringt, während wir die ersten Pflänzchen vom schützenden Vlies befreien und an die wärmende Sonne lassen. Sie ist eine der Initiantinnen von Selbsterntegarten.ch, Quereinsteigerin in die Landwirtschaft und Bäuerin. Auf ihrem Hof Summerweid oberhalb von Sarnen, der auch Teil unseres Höfenetzwerks ist, entstand 2020 der erste Garten nach dem Selbsternte-Prinzip. Inzwischen gibt es in den Kantonen Ob- und Nidwalden, Luzern und Aargau zehn Selbsterntegärten.
Solidarisch, biologisch, partizipativ
Der Selbsterntegarten Kloster Sarnen ist einzigartig und doch typisch. «Wir waren auf der Suche nach einem weiteren Standort in Sarnen. Von unserem Hof sehe ich aufs Dorf, mittendrin liegt das Kloster. Und ich dachte: Das wäre ideal, denn die Nähe zu den Konsumentinnen ist wichtig, damit die Gärten funktionieren», erzählt Olivia. Nach anfänglicher Skepsis und mit leicht angepasstem Konzept geht der Selbsterntegarten im Kloster nun in die vierte Saison. Als einziger Standort hat er Öffnungszeiten, die den Klosteralltag respektieren. Sr. Gabriela ist die Ansprechperson vor Ort und arbeitet im Garten mit – im Austausch gegen Gemüse für die Küche der Benediktinerinnen.
Ansonsten funktioniert auch der Klostergarten nach dem Konzept, das Olivia und Madeleine entwickelt haben: Die Abonnentinnen ernten von Mitte April bis Mitte Oktober Bio-Gemüse, Blumen und Kräuter selbst und wann sie möchten direkt im Garten. Je nach Standort und verantwortlicher Bewirtschafterin vor Ort gibt es zusätzlich Beeren, Obst, Fleisch oder Eier im Abo. In einem Chat werden die Konsumenten wöchentlich informiert, was es wo zu ernten gibt. Das erntereife Gemüse ist jeweils mit Fähnlein oder Schildern markiert. «Das funktioniert gut», erzählt Olivia. «Was die einen Abonnenten stehen lassen, ernten dafür die anderen.» Am Helfermorgen im Frühling und Herbst arbeiten die Konsumentinnen im Garten mit.
Erfolge wie auch Risiken werden geteilt
Die Selbsterntegärten funktionieren nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Die Abonnentinnen bezahlen das Gemüse mit einem Pauschalbeitrag im Voraus. Bei guten Bedingungen gibt es mehr als genug Gemüse für alle, bei schwieriger Witterung oder Schädlingsbefall müssen Abstriche bei Menge und Qualität gemacht werden. «Wieder nah an der Produktion von Lebensmitteln zu sein, hat einen enormen Sensibilisierungseffekt und grossen didaktischen Wert», betont Olivia. Dass die Menschen ihr Gemüse selbst im Garten ernten, macht den Unterschied. Denn viele Fragen und Gespräche entstehen direkt vor Ort. «Ein Aspekt, den wir unterschätzt haben», räumt Olivia ein. «Der Austausch mit den Kunden ist schön, braucht aber eben auch Zeit.»
Ein Garten von 600 bis 1000 m2 ermöglicht es rund 20 Familien und Einzelpersonen, sich während der Saison vollumfänglich selbst mit Gemüse zu versorgen. Das ist auch die Grösse, die es mindestens braucht, um einen Selbsterntegarten wirtschaftlich zu betreiben. «Wir versuchen, die Preise tief zu halten, damit sich möglichst viele Leute gesundes Gemüse leisten können. Gleichzeitig wollen wir unsere Arbeit fair entlöhnen», erklärt Olivia. Mit den Abos bezahlt die Gemüsekooperative das Saat- und Pflanzgut, die Betriebsmittel sowie das Personal für die Facharbeit. Gartenplanung, Koordination wie auch die wöchentlichen Gartenarbeiten werden professionell von den Bewirtschafterinnen an den jeweiligen Standorten ausgeführt.
Idee mit Potenzial
Mit der Anzahl Gärten ist auch die Organisation professioneller geworden. Inzwischen haben sich Olivia und Madeleine als Verein organisiert und zusätzliche Unterstützung geholt. Im Sinne des Franchisings stellt Selbsterntegarten.ch das Konzept, die Markenrechte und das Corporate Design anderen Bewirtschaftern gegen eine finanzielle Entschädigung zur Verfügung. Inbegriffen ist dabei Unterstützung durch professionelle Gärtnerinnen bei der Anbauplanung sowie bei der Bestellung von Saat- und Pflanzgut. Olivia freut sich, dass ihre Idee Wurzeln schlägt und ist offen für Gärten in weiteren Kantonen und an neuen Standorten: «Ich könnte mir einen Selbsterntegarten sehr gut auch auf dem Gelände eines Unternehmens für die Angestellten oder in einer Genossenschafts-Siedlung vorstellen.»
In der Tradition der Community GardensSelbsterntegärten reihen sich ein in die Tradition der Gemeinschaftsgärten, die im 19. Jh. als Reaktion auf die sozialen Herausforderungen der Industrialisierung und Urbanisierung entstanden. Seither haben sie sich stark gewandelt – von Armengärten und Selbstversorgungsflächen in Krisenzeiten und nach einem Bedeutungsverlust ab 1950 durch den Boom der Supermärkte zu vielseitigen urbanen Begegnungsorten. Ab den 1970er Jahren erlebten sie einen Aufschwung, vor allem in Städten wie New York, gegründet von Bürgerinitiativen als Antwort auf soziale und ökologische Missstände. Heute sind sie grüne Oasen, Integrations- und Bildungsorte und spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung nachhaltiger, lokaler Ernährungssysteme in urbanen Gebieten und darüber hinaus. |